STARTSEITE I AKTUELLES I PETER MARGGRAF I BILDHAUER UND ZEICHNER I SAN MARCO HANDPRESSE I VENEDIGPROJEKT I I LIBRI BIANCHI I KONTAKT
 |
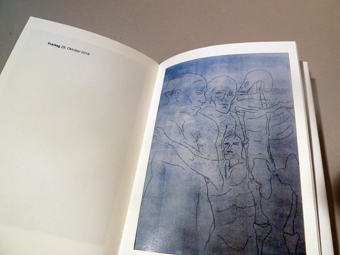 |
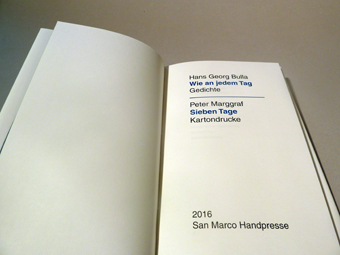 |
Über ein neues Buch von Hans Georg Bulla und Peter Marggraf
Wer oder was ist Prometheus? Eine schillernde,
zwielichtige Figur. Ein Projektionsidol, das nach den eigenen Wünschen und
Hoffnungen passend gemacht werden kann. Ein Schlaumeier, ein Wohltäter, ein
Aufklärer, ein Rebell, ein Unheilbringer. Es ist eine undurchsichtige
charakterliche Gemengelage, die uns der Mythos beschert hat, der sich, das
muß man ihm als mildernden Umstand zugute halten, aus verschiedenen, sich
widersprechenden Quellen speist.
In dieser Situation halte ich es wie
Prometheus selbst, ich packe ihn am Portepee, ich nagle ihn auf einen der
ihm zugeschriebenen Charakterzüge fest: Da er auch den ersten Menschen aus
Lehm geschaffen haben soll, ist er für mich der Kreative schlechthin, denn
diese Schöpfungstat hatte enorme Folgen – die Menschen selbst entpuppten
sich (wenn auch nicht generell, ja genau betrachtet nur in wenigen
Einzelfällen) als Kreative. Eine Kettenreaktion ohne Ende.
Mit dieser
kleinen, wenn auch weit ausholenden Introduktion bin ich bei meinem
eigentlichen Thema angelangt: Es geht um die beiden Kreativen Hans Georg
Bulla und Peter Marggraf. Jeder hat für sich (und zunächst ohne Kenntnis vom
Wirken des anderen) seinen Kosmos und seine Gestalten geschaffen („Hier
sitz’ ich, forme Menschen / Nach meinem Bilde“). Dabei hätte es auch bleiben
können, der eine hätte sich im Reich der Literatur positioniert, der andere
in dem der Kunst, sie wären durch Lichtjahre voneinander getrennt gewesen
und hätten bestenfalls in Feuilletons schöngeistiger Blätter die Existenz
des Antipoden flüchtig wahrgenommen.
Durch einen glücklichen Zufall aber
haben sich die Wege der beiden Ende der 80er-Jahre gekreuzt. Workshops,
Seminare, Ausstellungseröffnungen, Texte standen am Anfang der Kooperation,
und nachdem Peter Marggraf in den 90er-Jahren seine San Marco Handpresse
gegründet hatte, kam es zur Symbiose: 1997 erschien Hans Georg Bullas Band
„Flügel über der Landschaft“. Gedichte lieferte der eine, für die
ästhetische Buchform sorgte der andere.
Aber das war noch nicht alles.
Bei diesem Band trat der Büchermacher auch als Künstler in Erscheinung und
komplettierte die Texte mit Grafiken – ein neues „Format“ war geboren, ein
Gesamtkunstwerk, das den Anfang einer ganzen Reihe von
Kunst-Literatur-Objekten dieser Art markierte. Mehr als zehn Mappen und
Bücher sind mittlerweile entstanden. Die prometh-eischen Dioskuren haben
ihre separat geschaffenen Welten miteinander vereinigt. Zumindest
zeitenweise und in ausgewählten Projekten.
Daß das Tandem Peter Marggraf
und Hans Georg Bulla auch Aufnahme in die einzigartige Sammlung Hartmann in
der Vorarlberger Landesbibliothek Bregenz gefunden hat, erscheint, trotz
glücklicher Begegnungen und Konstellationen, wenn nicht gerade
unausweichlich, so doch logisch. Schrift-Bilder und Figuren-Bilder, so die
Idee des Sammler-Ehepaars, sollen sich ergänzen, zusammenklingen, sich
gegenseitig erweitern und verstärken. Das Ganze wäre dann mehr als die Summe
der Teile.
Brigitte und Gerhard Hartmann sind nicht bloße Archivare, die
nur ihre Regale füllen wollen, sondern inspirierende Auftraggeber. Haben sie
sich für einen Schriftsteller entschieden und ist dieser bereit, Autographen
zur Verfügung zu stellen, so suchen sie einen bildenden Künstler, den sie
für geeignet halten, kongeniale Bilder zu schaffen.
Und hier wird’s
interessant. Oder auch problematisch. Denn was geschieht, wenn der Künstler
seiner Aufgabe nicht gerecht wird? Wenn der Leser und Betrachter, also der
Konsument und Laie, beim besten Willen keine Verbindung zwischen Text und
Bild erkennen kann?
Keine Sorge, hier springt die Fachkraft in die
Bresche. Das ist der Interpret, der, wenn es sein muß, mit einem tollkühnen
Spagat den Abgrund überbrückt. Etwas geht immer. Die Aufgabe des Interpreten
wird enorm erleichtert, wenn die Bilder mehr oder weniger abstrakt sind.
Dann kann es sein, daß das Objekt sehr nett und dekorativ wirkt, und eine
zweite Fachkraft, der Kritiker, kann guten Gewissens das Prädikat „stimmig“
verleihen.
Doch will ich hier nicht zu sehr theo-
retisieren, sondern
die Probe aufs Exempel machen. Ich wähle den Band: Hans Georg Bulla, „Wie an
jeden Tag“; Peter Marggraf, „Sieben Tage“, erschienen in der San Marco
Handpresse 2016. Soviel ich weiß, ist das Buch nicht im Auftrag eines
Dritten entstanden, und es ist auch (bis jetzt) in keine Sammlung
aufgenommen worden. Die Frage ist: Passen Marggrafs Zeichnungen zu Bullas
Texten? Und: Sind sie mehr als schmückendes Beiwerk?
Ohne zunächst auf
Details einzugehen, kann man generell sagen: Es besteht eine grundsätzliche
Affinität zwischen den Kollaborateuren. Sie haben beide ein handwerkliches
Ethos. Peter Marggraf ist nicht nur ein sorgfältiger Büchermacher, sondern
beweist auch mit seinen Skulpturen, Fotografien, Zeichnungen und Drucken,
daß er nicht bestrebt ist, etwas genialisch hinzuhauen. Die Arbeiten haben
Hand und Fuß, man spürt, daß der Künstler nicht dem Widerstand der
Wirklichkeit ausweicht. Er ringt dem Stoff eine Form ab. Daß Marggraf im
Prinzip gegenständlich arbeitet, kommt der handwerklichen Grundeinstellung
entgegen – im Abstrakt-Ungefähren läßt sich leichter schummeln.
In den
Texten von Hans Georg Bulla zeigt sich das Handwerkliche in anderer Weise.
Es ist spürbar im sorgfältigen Umgang mit den Wörtern. Da wird jedes gewogen
und an den ihm gemäßen Platz gestellt. Flotte, vom Zeitgeist getragene,
Aufsehen erregende Formulierungen wird man nicht finden. Bulla ist, formal
gesehen, ein konservativer Autor, und das in positivem Sinne. Man fühlt sich
bei ihm auf sicherem Boden und muß sich nicht angesichts verblüffender
gedanklicher Volten die bange Frage stellen: Was will uns der Dicher
eigentlich sagen? Seine Kunst besteht darin, das scheinbar Bekannte mit
kleinen Verschiebungen und feinen Nuancierungen in einem neuen,
überraschenden Licht erscheinen zu lassen. Wobei dieses neue Licht etwas
Bodenloses und Abgründiges offenbaren kann.
Die handwerkliche
Grundeinstellung von Autor und Künstler wäre also eine solide Basis für ein
gelingendes Zusammenwirken, aber natürlich erwartet man noch mehr, etwas
Spezifisches in diesem besonderen Fall, bei diesem konkreten Buch. Schaut
man sich Peter Marggrafs Zeichnungen an, so fällt auf, daß sie von Figuren
beherrscht werden. Wäre es da nicht schön, wenn die Lyrik primär vom Raum
geprägt würde, so daß sich Bild und Wort wunderbar ergänzten? Marggrafs
Gestalten würden in Bullas Bühnenraum auftreten, und alles wäre stimmig und
perfekt.
Funktioniert aber nicht ganz so. Die Welt der Kunst fügt sich
selten den sauber trennenden Kategorien des Verstandes. In Bullas lyrischer
Welt gibt es nämlich beides, den Raum und die Figuren. So müssen wir also
zunächst im Falle Marggraf einen defizienten Modus konstatieren. Bullas
Gedichtwelt wird nur zur Hälfte widergespiegelt.
Vielleicht kommen wir
weiter, wenn wir uns klarmachen, was für diesen lyrischen Kosmos
charakeristisch ist. Kosmos? Vielleicht ist dieser Begriff hier eine Nummer
zu groß, denn in fast zwei Dritteln der 41 Gedichte bilden Dorf und Land den
Bühnenraum, wenn der Vergleich gestattet ist. Bulla ist kein urbaner
Dichter, kein Villon („mich kitzelt der Geruch der großen Stadt“). Aber man
darf sich da nicht in die Irre führen lassen, Dorf bedeutet in diesem
Zusammenhang nicht: hinter den sieben Bergen, eine weltabgeschiedene Idylle,
die den Anschluß an die Aktualität verloren und deshalb uns modernen
Menschen nichts zu sagen hat. Das Dorf ist hier eher eine existenzielle
Metapher, ein übersichtliches Bezugssystem: wenige Menschen, die nicht in
einem Gewimmel untergehen und sich noch in die Natur eingebettet fühlen.
Andererseits: Baum, Kraniche, Gartenbeet, Wildpferde, Katzen, Stare, Wiese,
Scheune, Wolken, Bussard, Gräser – das klingt ja im Zeitalter des
Smartphones, der sozialen Netzwerke, der virtuellen Realitäten, der
künstlichen Intelligenz usw. ziemlich „uncool“. Allerdings haben diese
zauberhaften modernen Erfindungen die fatale Nebenwirkung, daß sie einen
Schleier legen über die existenzielle Situation des Menschen, die trotz
aller Fortschritte gleichbleibt. Der täuschende Schleier der Maja. In den
ländlichen, dörflichen Szenerien der Gedichte dagegen zeichnen sich die
elementaren Gegebenheiten des menschlichen Lebens unverhüllt, schroff, ja
unversöhnlich ab.
Mit der Kategorie „Dorf und Land“ sind natürlich noch
nicht alle Raumvorstellungen in der Gedichtauswahl erfaßt. Man müßte zum
Beispiel im Auge behalten, wie an manchen Stellen die Stadt in das Land
hineingreift, welche Rolle Innenräume spielen oder was Zeiträume bedeuten,
wenn beim Betrachten von alten Fotos die Vergangenheit aufsteigt. Lassen wir
das auf sich beruhen, und beschäftigen wir uns mit den Figuren, die in den
Räumen agieren. Wer ist das?
Es ist der Landvermesser, der Nachbar, der
Gärtner, der Vater, eine Frau, die den Wäschekorb trägt, der Schwimmer, die
Scherenschnitterin, die Kinder, ein Gleisarbeiter, ein Blinder, die Köchin,
der Herr Pastor, eine Frau, die gestorben ist, ein Steinesammler, der den
Tod wählt, die Toten. Die Liste ist sicher nicht vollständig. Man hat auch
das Gefühl, daß manche Tiere dasselbe Gewicht wie die Menschen haben.
Überdies scheint es angemessen zu sein, besser von Gestalten als von Figuren
zu sprechen. Figuren kann ein Puppenspieler hin und her schieben, Gestalten
dagegen haben ein Eigenleben.
Zu diesen Gestalten, die eindeutig beim
Namen genannt werden, kommen noch besondere dazu: ein Ich und ein Du. Sie
sind einerseits viel weniger konturiert als die oben genannten, andererseits
suggestiver und beherrschender. Wobei das Ich die letzte Instanz ist. Das Du
kann ein Ich aus früheren Zeiten sein, so daß der vermeintliche Dialog in
Wahrheit ein Selbstgespräch ist.
Es läßt sich nicht schlüssig beweisen,
aber eine Theorie aus der Traumdeutung könnte zutreffen: Alle Gestalten sind
im Grunde Emanationen des Ichs. Natürlich ist der Gärtner, um ein Beispiel
zu geben, eine Gestalt für sich, möglicherweise hat der Dichter einen
Menschen vor Augen, dem er im wirklichen Leben begegnet ist. Aber so, wie er
im Gedicht dargestellt wird, drückt er die Gefühle und die Seinserfahrung
des Schreibenden, Imaginierenden, Beschwörenden aus: „ich knie im leeren
Beet, / grabe meine Hände / ein, beide zugleich, / ich bitte darum, / tut
sich aber nicht / auf, die Erde“.
Das wäre eine skizzenhafte Darstellung
der lyrischen Welt von Hans Georg Bulla, wie sie uns in „Wie an jedem Tag“
erscheint, unter dem Gesichtspunkt „Raum und Figuren“. Wie sieht es nun in
Peter Marggrafs „Sieben Tage“ aus, den sieben Kartondrucken, die als
künstlerische Entsprechung gedacht sind?
Wie schon erwähnt, ist der Raum
hier kein Thema, es dominieren die Figuren. Natürlich geht es auch bei
dieser Darstellungsweise nicht ganz ohne Raum ab, denn wenn Figuren
nebeneinander gestellt werden, ergibt sich zwangsläufig eine Trennung, also
ein Zwischenraum. Aber dieser Raum ist eine Quantité négligeable, darauf
brauche ich hier nicht einzugehen.
Wenn oben gesagt wurde, bei Bulla sei
es angemessener, von Gestalten als von Figuren zu sprechen, scheint es sich
bei Marggraf eher um Figuren zu handeln, ohne daß damit eine Wertung
abgegeben wird. Diese Figuren haben etwas seltsam Flächenhaftes, als wären
sie gar nicht in der Lage, einen Raum zu füllen. Die Gesichter ähneln
einander, fast könnte man meinen, es sei ein und dieselbe Person, deren
Gesicht aus verschiedenen Perspektiven und in unterschiedlicher Größe
gezeigt wird. Eigenartig sind auch die Augen. Sie blikken wie erstarrt, als
könnten sie nichts fixieren, nichts wahrnehmen oder begreifen. Was hat das
zu bedeuten?
Auf einer Zeichnung erscheint eine Figur, die sich markant
von den anderen unterscheidet. Es ist ein Gerippe. Der Kopf ist ein Schädel,
das Auge eine Augenhöhle, mit der das Wesen paradoxerweise auch zum Blick
fähig ist. Da fällt es uns wie Schuppen von den Augen: Wir befinden uns in
einer Totenwelt, in einem Hades, in einem blaugrauen Kontinuum, in dem Raum
und Zeit keine Rolle spielen. Wenn die Reihe der Zeichnungen „Sieben Tage“
heißt, so ist das eine absichtsvoll gewählte Absurdität. In dieser Welt gibt
es keine Tage und keine Zählung. Hier gibt es kein Miteinander, kein
Gespräch, keine Wärme. In einer Zeichnung wird eine Umarmung dargestellt,
aber sie wirkt wie versteinert.
Zu dieser Deutung paßt das letzte Gedicht
von Bulla „Aus einem alten Bericht“, das wohl als Schlußwort zu verstehen
ist. Dort ist von einem Dorf die Rede, einem fernen mit fremden Gebräuchen,
in dem versucht wird, die Körper der Toten mit verschiedenen Maßnahmen eine
Zeitlang zu erhalten: „Damit die Toten länger / bei uns sind.“
Tod und
Vergänglichkeit sind bei Bulla markante Motive, sie finden sich in einem
knappen Drittel der Gedichtsammlung. Andere Gedichte wirken wie die Notate
eines genauen, sensiblen Beobachters, der Zusammenhänge sichtbar macht, wo
andere nichts Mitteilenswertes erkennen können. Insgesamt ist die Stimmung
eher melancholisch. In wenigen Gedichten, in denen Tiere, etwa Katzen, Vögel
oder Pferde, die Akteure sind, ist der Ton etwas lockerer. Man hat den
Eindruck, daß sich eine dunkle Wolke herabsenkt, wenn das Bewußstein
jenseits des Animalischen erwacht.
Das ist eine Weltsicht, die ihre
Berechtigung hat, auch wenn damit nicht alle Seiten des Seins erfaßt sind.
Peter Marggrafs Totengalerie ist eine Art Interpretation der Texte, sie
verstärkt die dunkle Stimmung. Eine zweite Bedeutungsdimension schiebt sich
hinter die Worte.
Marggrafs Figuren wirken wie Röntgenbilder von Bullas
Gestalten. Der Nachbar, der Gärtner, der Vater – das sind Menschen, die
etwas tun und mit ihrem Tun beweisen, daß sie am Leben sind. Die Bilder aber
umgeben sie mit der schicksalhaften Aura der Vergänglichkeit. Einerseits
noch erwärmt vom Licht des Lebens, stehen sie zugleich im Schatten des
Todes.
Eine hoffnungslose Situation? Ja. Und dennoch gibt es da etwas,
was über das unausweichliche, eherne Schicksal hinausweist. Man könnte es
einen Funken nennen. Kein Funken der Hoffnung, es ist eher ein schwacher
Schimmer, eine Denkmöglichkeit, ein Spalt in einer schwarzen Wand.
In
Bullas Gedicht über die Toten in dem fremden Dorf heißt es: „Wir hocken uns
/ zu ihren Füßen, / hören, was sie uns / erzählen und wie sie / singen.“
Wort und Musik schaffen also eine Verbindung zwischen der Welt der Lebenden
und der Welt der Toten. Es steht zwar so nicht im Gedicht, aber man könnte
sich vorstellen, daß es auch die Toten sind, die da hocken und den
Geschichten und dem Gesang der Lebenden lauschen. Und sich so an das
wunderbare Leben erinnern mit seinen Farben, Gerüchen, Klängen und
unendlichen Geheimnissen.