STARTSEITE I AKTUELLES I PETER MARGGRAF I BILDHAUER UND ZEICHNER I SAN MARCO HANDPRESSE I VENEDIGPROJEKT I I LIBRI BIANCHI I KONTAKT
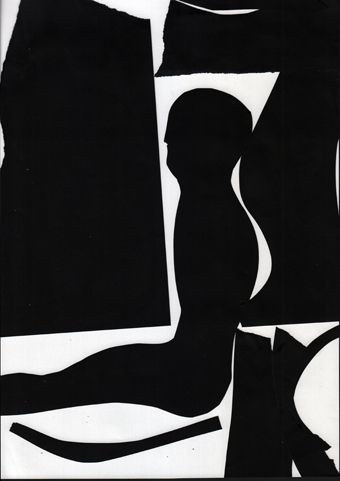 |
.jpg) |
.jpg) |
i libri bianchi band 71
DAS GESICHT DER NACHT
Gedichte von Hannah
Arendt und
Scherenschnitte von Peter Marggraf
Von Evelin Eberle
„Des
Glückes Wunde
heisst Stigma, nicht Narbe.
Hiervon gibt Kunde
Nur Dichters Wort.
Gedichtete Sage
ist Stätte, nicht Hort.“
(Hannah Arendt)
In der Reihe „I libri
bianchi“ erscheint ein neuer Band, der eine überraschende Seite der großen
Denkerin Hannah Arendt sichtbar macht: ihre Gedichte. Zusammengetragen und
sorgfältig ediert, zeigen sie eine sehr persönliche, poetische Stimme, die
neben ihrem bekannten philosophischen Werk bisher kaum wahrgenommen wurde.
Begleitet werden diese Texte von Scherenschnitten des Künstlers Peter
Marggraf, die eigens für diesen Band geschaffen wurden und dem Thema „Das
Gesicht der Nacht“ gewidmet sind. Die Verbindung von Wort und Bild eröffnet
ein Spannungsfeld, das die Gedichte Arendts in einen neuen ästhetischen Raum
stellt.
Hannah
Arendt wurde am 14. Oktober 1906 in Linden bei Hannover geboren.
Aufgewachsen in einer assimilierten jüdischen Familie, zeigte sie schon früh
eine große geistige Begabung. Sie studierte Philosophie, Theologie und
Griechisch. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde Arendt
wegen ihrer jüdischen Herkunft verfolgt. 1933 floh sie zunächst nach Paris.
Dort lernte sie auch ihren späteren Ehemann Heinrich Blücher kennen. 1941
gelang ihr mit ihm die Flucht in die Vereinigten Staaten, wo sie sich in New
York niederließ.
In Amerika begann Arendt ihre Karriere als politische Theoretikerin. Sie
arbeitete als Journalistin, Redakteurin und Universitätslehrerin. Ihre
Bücher machten sie international bekannt: „Elemente und Ursprünge totaler
Herrschaft“ (1951) gilt bis heute als eine der wichtigsten Analysen des
Totalitarismus, während „Vita activa“ (1958) eine tiefgreifende Untersuchung
der Bedingungen menschlichen Handelns vorlegte. Arendt starb am 4. Dezember
1975 in New York. Ihr Werk bleibt ein unverzichtbarer Bestandteil
politischer und philosophischer Debatten.
Weniger bekannt ist, daß Arendt auch Gedichte
schrieb, vor allem in den 1930er und 1940er Jahren, während der Zeit des
Exils. In diesen Gedichten spiegeln sich Erfahrungen von Heimatverlust,
Fremdheit und Entwurzelung, aber auch Momente der Hoffnung und der
Selbstbesinnung. Ihre Sprache ist dicht und bildreich, teils vom
Expressionismus geprägt, teils von klassischer Strenge.
Die Gedichte geben Einblick in eine Seite von
Arendt, die hinter der analytischen Schärfe ihrer philosophischen Schriften
oft verborgen blieb: eine verletzliche, tastende Stimme, die im poetischen
Ausdruck nach einem Halt in der Welt suchte. Gerade darin liegt ihr Reiz –
sie lassen die Denkerin auch als Künstlerin erkennen, die mit Worten nicht
nur argumentierte, sondern auch verdichtete Bilder und Klänge schuf.
Einen Höhepunkt in Arendts öffentlichem Wirken
bildete ihre Berichterstattung über den Eichmann-Prozeß in Jerusalem im
Jahre 1961. Die „New Yorker“ bat sie, den Prozeß zu beobachten und in einer
Serie von Artikeln zu kommentieren. Arendt reiste nach Israel und verfolgte
die Verhandlungen gegen Adolf Eichmann, den Organisator der Deportationen in
den Tod.
Aus
dieser Erfahrung entstand das Buch „Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von
der Banalität des Bösen“ (1963). Darin prägte sie den viel diskutierten
Begriff von der „Banalität des Bösen“. Eichmann erschien ihr nicht als
dämonischer Massenmörder, sondern als ein funktionaler Bürokrat, unfähig zu
eigenem Denken, der blind Befehle ausführte. Diese Deutung löste weltweit
heftige Kontroversen aus. Viele warfen Arendt vor, sie habe die Opfer
vernachlässigt oder den Tätern zuviel Verständnis entgegengebracht. Doch
gerade die Provokation machte ihr Buch zu einem Schlüsseltext des 20.
Jahrhunderts.
Für
den neuen Band mit Arendts Gedichten hat der Künstler Peter Marggraf eine
Serie von Scherenschnitten geschaffen. Marggraf ist als Drucker, Zeichner,
Bildhauer und Büchermacher bekannt, dessen Arbeiten stets eine enge
Verbindung von Kunsthandwerk und geistigem Anspruch aufweisen. Die
Scherenschnitte zum Thema „Das Gesicht der Nacht“ bestehen aus schwarzem
Papier, das er sowohl riß als auch schnitt, um figürliche Darstellungen im
Format 30 x 42 cm zu gestalten. Durch die Verbindung von Schärfe und Bruch,
von Linie und Fläche, entsteht eine kraftvolle Bildsprache, die die Gedichte
Arendts um eine visuelle Dimension bereichert.
Scherenschnitte haben in der bildenden Kunst eine
lange Tradition. Im 18. und 19. Jahrhundert waren sie eine populäre Form
häuslicher Kunst. Im 20. Jahrhundert erhob Henri Matisse die Technik zu
einer neuen, modernen Ausdrucksform. Seine berühmten „papiers découpés“, die
er in den 1940er und 1950er Jahren schuf, zeigen, wie aus der Reduktion auf
Schnitt und Farbe eine radikale Bildsprache entstehen kann. Marggrafs
Arbeiten stehen in dieser Tradition, zugleich aber entwickeln sie eine
eigene, zeitgenössische Handschrift. Während Matisse mit leuchtenden
Farbflächen arbeitete, konzentriert sich Marggraf auf das Schwarz des
Papiers und die Spannung zwischen Riß und Schnitt. So entsteht ein
Wechselspiel von Dunkel und Licht, von Figur und Leere, das mit Arendts
Gedichten in einen fruchtbaren Dialog tritt.
Das Zusammenspiel der beiden Ausdrucksformen –
Arendts Poesie und Marggrafs Scherenschnitte – macht den besonderen Reiz des
Bandes aus. Arendts Worte tragen die Erinnerung an Entwurzelung, Verlust und
Neuanfang, während Marggrafs Bilder durch ihre klare, harte Formensprache
eine visuelle Verdichtung derselben Themen schaffen. Das „Gesicht der Nacht“
erscheint als Metapher für Abschluß, Dunkelheit, aber auch für die
Möglichkeit eines neuen Beginns.
Die Einbindung dieser Scherenschnitte in das Buch
entspricht dem Geist der Reihe „I libri bianchi“, die sich stets der
Verbindung von Literatur und Kunst verschrieben hat. Der Band ist damit
nicht nur ein literarisches, sondern auch ein kunsthandwerkliches Objekt,
das die Tradition des bibliophilen Buches fortführt.